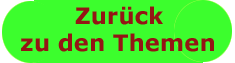
bearbeitet: 10.01.2003
Über das Denken der Rechtschreibreformer
An dieser Stelle soll das Denken der Rechtschreibreformer einer kleinen aber aufschlußreichen Analyse unterzogen
werden. Zu dieser Analyse soll nur das Kapitel Getrennt- und Zusammenschreibung herangezogen werden,
damit der Beitrag eine lesbare Länge behält. Vielleicht nehme ich später noch andere Kapitel her, in denen das
Drama das gleiche ist.
Am Beispiel der Getrennt- und Zusammenschreibung lassen sich einige Dinge sehr klar zeigen. Nehmen wir die beiden
deutschen Ausdrücke „sogenannt“ und „so genannt“ unter die Lupe und zeigen den Unterschied. Angenommen, es
liegt uns ein Plan vor, aus dem wir die Planungsobjekte für den laufenden Tag entnehmen und in einen gesonderten
Teilplan eintragen, den wir Tagesplan nennen wollen. Das ist dann der so genannte Tagesplan, so haben wir ihn
benannt. Kommt nun ein Dritter daher, und spricht von dem sogenannten Tagesplan, so will er ausdrücken, daß er
sich mit diesem Plan nicht so ganz identifizieren kann, dieser sogenannte Tagesplan ist für ihn unsinnig oder lächerlich,
er akzeptiert ihn innerlich nicht.
Man sieht also, daß die beiden Ausdrücke eine sehr unterschiedliche Bedeutung haben, was man beim Sprechen mit
der Betonung zum Ausdruck bringt. Beim Lesen hat man diese unterschiedliche Betonung nicht zu Verfügung, folglich
ist man auf die unterschiedliche Schreibweise angewiesen, wenn man den Sinn erkennen will.
Wäre den Rechtschreibreformern dieser Unterschied der beiden Ausdrücke aufgefallen, wären sie sicher niemals auf
die Idee gekommen, die Bedeutung „sogenannt“ aus der deutschen Sprache streichen zu wollen. Das läßt aber nur
einen einzigen Schluß zu: Die Reformer kennen diesen Unterschied nicht, für sie haben die beiden Ausdrücke die
gleiche Bedeutung, deshalb kam es für sie auch nur darauf an, die Schreibung zu vereinheitlichen.
Ihr Denken ist also nicht weit genug entwickelt, die Feinheiten der Ausdrucksweise im Deutschen
zu erkennen, sie sind also für die Erarbeitung einer Reform ungeeignet, sie sind inkompetent.
Es fehlt ihnen das Sprachgefühl und sie sind unzureichend gebildet und ausgebildet,
die Schriftsprache einer Reform zu unterziehen.
Bei ihrem Tun stützen sie sich auf Weisungen der Kultusministerkonferenz, die sich anmaßt, eine Reform auf Anweisung
betreiben zu lassen, und die Ergebnisse dieser Fehlleistung dann auch noch „amtlich“ zu nennen. Bedauerlicherweise
gibt es eine große Zahl unter den Deutschen, denen es egal ist, wie sie schreiben oder schreiben sollen, die gehorsam,
untertänig und obrigkeitshörig so schreiben, wie man es ihnen „befiehlt“. Wenn es eben amtlich ist, dann müssen wir
das so machen. Und so machen sie es denn, auch wenn es kompletter Unfug ist. Das muß wohl so in der Seele des
Deutschen liegen. Jeder sprachbewußte Mensch aber kann nicht anders, als sich dagegenzustellen. Mir ist aufgefallen,
daß kein namhafter deutscher Schriftsteller das Reformerdeutsch anwendet. Kann er auch gar nicht. Er arbeitet mit den
Feinheiten der deutschen Sprache, die die Reform ihm wegnehmen will.
Das Verheerende an diesen Aktionen ist, daß nicht nur orthographische Änderungen herbeigeführt werden sollen,
sondern daß unmittelbar in die Sprache selbst eingegriffen wird, indem Ausdrucksweisen beseitigt werden sollen.
Für das Streichen von Ausdrücken aus der Sprache gibt es jedoch überhaupt keine zuständigen
Stellen, niemand hat dazu Rechte oder gar Pflichten, kein Amt, keine Behörde, kein Gericht, auch nicht das
Bundesverfassungsgericht, keine Universität, keine Partei, kein Verein oder was auch immer –
und auch nicht die Kultusministerkonferenz. Dies geschieht ausschließlich durch natürliche Sprachentwicklung im
Volk, die beobachtet und dokumentiert werden kann, beispielsweise durch ein sprachwissenschaftliches Institut.
Nun werden einige Reformbefürworter entgegenhalten, man könne ja seine Formulierungen so gestalten, daß der
Sinn aus dem Kontext erkennbar wird. Die Kontexterkennung ist sehr nützlich, wenn es um Zweifelsfälle geht, die
trotz aller Feinheiten der Ausdrucksweise auftreten können. Für die Reformbestrebungen ist sie allerdings als Begründung
nicht akzeptabel, sie ist Beschwichtigungsversuch und ganz billige Ausrede. Wir haben historisch gewachsen im Deutschen
in den meisten Fällen Eindeutigkeit durch unterschiedliche Schreibweisen, warum wohl sollten wir darauf verzichten? Weil
dafür notwendige Schreibweisen abgeschafft werden sollen? Es gibt dafür keinen vernünftigen Grund.
Nun wären meine Anfeindungen gegen die Reformer sicher nicht aufrechtzuerhalten, wäre das genannte Beispiel der
einzige Fehlgriff der Reformer. Aber Stephanus Peil hat in seiner Broschüre „Die Wörterliste“ gezeigt, daß in der
alphabetischen Wortfolge allein beim Buchstaben A einige hundert Ausdrücke aus der deutschen Sprache gestrichen
werden sollen. Insgesamt sind es viele Tausende. Zur Unterstreichung meiner Aussagen will ich nur noch einige wenige
ausdeuten. Rund 360 Beispiele finden Sie im Beitrag "Die kuriose Welt der
Getrenntschreibung".
Titelzeile in einer Ausgabe der
Münchener Abendzeitung vom April 2000 über einen Verkehrsunfall: „Frau tot gefahren und dann geflüchtet“. Gesagt
werden sollte an dieser Stelle, daß eine Frau ums Leben gekommen ist und der Täter danach das weite gesucht hat,
also „Frau totgefahren und dann geflüchtet“. Geschrieben steht aber, daß die Frau, die gefahren ist, schon tot war,
möglicherweise durch einen plötzlichen Herzinfarkt oder was auch immer. Wie sie dann aber geflüchtet sein soll, ist
ein Rätsel. Der Redakteur hatte sicher allzuviel „Logik“ walten lassen: „tot geboren“ soll ja nach dem Neuregelpfusch
zwingend getrennt geschrieben werden, „tot stellen“ auch, warum dann nicht auch „tot gefahren“? Leider ist aber diese
Reformerlogik unverträglich mit der Logik in der deutschen Sprache.
Der Literaturkritiker Joachim Kaiser hat in der Süddeutschen Zeitung vom 01.10.1999 geschrieben: „Der Nobelpreis für
Günter Grass war wohlverdient.“ Der Redakteur machte daraus, „Der Nobelpreis für Günter Grass war wohl verdient“,
was bedeutet, daß er so recht und schlecht berufen war, ihn zu erhalten. Ja, ja, „deutse Sprake – swere Sprake!“
Was soll man von folgender Formulierung halten? „Der CDU-Vorsitzende hat die Regierungserklärung des Bundeskanzlers
schlecht gemacht.“ Unklar ist hier, warum der CDU-Vorsitzende die Regierungserklärung des Bundeskanzlers gemacht hat.
Hätte Schröder die nicht selber machen müssen? Hätte er sie selbst gemacht, wäre sie bestimmt besser geworden.
Allein bei der Analyse der reformierten Getrennt- und Zusammenschreibung läßt sich in Hunderten Fällen zeigen, daß die
neuen Vorsehungen keinerlei Regel beinhalten und keinen vernünftigen Sinn mehr haben. Wenn
„aufeinander treffen“ statt „aufeinandertreffen“, warum dann aber
„zusammentreffen“? Wenn „allzu bald“ statt „allzubald“,
warum dann aber „allzumal“? Wenn „bewusst machen“
statt „bewußtmachen“, warum dann aber „klarmachen“? Wenn
„schlecht machen“ statt „schlechtmachen“, warum dann aber
„gutmachen“ und „schönmachen“? Wenn
„dahinter setzen“ statt „dahintersetzen“ und „davor setzen“
statt „davorsetzen“, warum dann aber „dazusetzen“ und
„danebensetzen“? All das ist schon völlig unverständlich. Der Gipfel ist aber wohl das
folgende: Für „abscheuerregend“ soll es neu heißen „Abscheu erregend“, aber für
„äußerst abscheuerregend“ soll es neu heißen „äußerst abscheuerregend“. Ich
versichere den Leser, ich habe mich hier nicht verschrieben. Was mag in den Köpfen solcher Leute
vor sich gehen, die uns das als „Reform“ andrehen wollen? Mit Denken kommen wir hier überhaupt nicht
weiter!
DMP