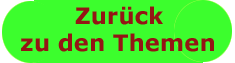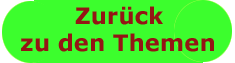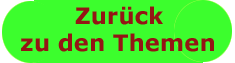
bearbeitet: 12.03.2014
ergänzt: 09.05.2015
Deutsch - Hyperaktiver Aktionismus mit unserer Sprache
Hyperaktiv nennt man einen Menschen, der übersteigert intensiv und übereifrig mit sich selbst und mit seiner Umgebung
umgeht. Hyperaktiven Aktionismus findet man auch in vielfältiger Form in unserer Sprache. Im mündlichen Ausdruck vieler
Menschen deutscher Muttersprache findet man - meist mit dem Ton unbedingter Wichtigkeit - zahlreiche Ausdrucks- oder
Stilformen, die auf ein Defizit der Beherrschung der deutschen Grammatik hinweisen. Viele dieser Fehler findet man auch
in der Sprache öffentlicher Personen oder Institutionen, zum Beispiel bei Politikern, in der Werbung, bei Moderatoren - die
ja Germanistik studiert haben (sollten) - oder auch in Ämtern und Behörden. Nun ist es beinahe üblich geworden, solche
exzessiven Sprachverbiegungen nicht als Fehler anzuerkennen, sondern sie damit zu rechtfertigen, daß eine Sprache ja
lebe und sich deshalb verändere. Was aber gegenwärtig mit unserer Sprache gemacht wird, ist des Guten zuviel. Es gibt
zu viele Leute, die sich berufen fühlen, die deutsche Sprache nach ihren Einzel- oder Privatvorstellungen verändern, sie
sagen, verbessern zu wollen, wodurch jedoch meist nur das Gegenteil erreicht wird. Das reicht von massenhaften
Rechtschreibreformen über politisch inszeniertes Genderdeutsch, über rätselhaftes Beamtendeutsch bis hin zu sintflutartigem
Überschwemmen des Deutschen mit englischem Vokabular. Eine große Zahl solcher "Sprachrevolutionäre" nennt die Verteidiger
der deutschen Sprachtradition die ewig Gestrigen, die den Wandel der Sprache nicht verstehen wollen. Eine große Zahl
Verunstaltungen unserer Sprache entsteht aber auch durch die zwanghafte Manie einiger Kreise der Gesellschaft, mit
übertrieben kraftstrotzenden Ausdrucksformen als besonders stark zu erscheinen, um ein übersteigertes Geltungsbedürfnis
zu befriedigen. Die Gesamtheit all dieser Aktionen gegen die deutsche Sprache zeigt aber genau das, was der deutsche
Humorist Loriot schon mit Seitenhieb auf die deutsche Sprachentwicklung aufs Korn nahm, indem er sagte: "In einigen
Generationen wird es genügen, sich grunzend zu verständigen."
Nachfolgend seien einige dieser Tendenzen und auch Einzelheiten angesprochen, ohne dabei eine systematische
Sprachwissenschaft zu bemühen. Der Leser kann solche Sprachmarotten mit Schmunzeln zur Kenntnis nehmen, jedoch
fände ich es sehr schön, würde die Aufzählung zum Nachdenken anregen und dazu bewegen, die eigenen Sprech-
und Schreibgewohnheiten selbstkritisch zu prüfen. Einige dieser Ausführungen sollen informieren, bei anderen hingegen
konnte ich nicht daran vorbei, mit einer angemessen kabarettistischen Darstellung manche Übertreibungen zu glossieren.
1. Unpassende Gleichnisse
Mit Begriffen aus der Wissenschaft wird oft versucht, vergleichend etwas verdeutlichen oder veranschaulichen zu wollen.
Oft geht das schief, weil der verwendete Vergleichsbegriff eine völlig andere Aussage hat, die dem Anwender oft wenig
oder nicht bekannt ist.
- Aus der Chemie:
Will man eine beurteilende Entscheidung einer Prüfung unterziehen, will also testen, ob Zweifel daran berechtigt sind
oder nicht, spricht man von einem Lackmustest. Hier wurde das englische litmus test ins Deutsche übernommen,
ohne zu bedenken, daß diese Sinnentsprechung im Deutschen nicht existiert. Es ist also einfach eine falsche Übersetzung,
das redensartliche Pendant für die deutsche Sprache ist der Prüfstein. Einigen ist es aber zu gewöhnlich, Püfstein
zu sagen, etwas Kraftstrotzenderes muß her, dabei ist auch Unsinn willkommen.
- Aus der Physik:
Will man einen großen Fortschritt, ein rasches Vorankommen verdeutlichen, so nennt man das einen Quantensprung.
Der Begriff, der den sprungartigen, diskreten Wechsel eines Teilchens in ein anderes Energieniveau bezeichnet, wird
heute vorzugsweise von Politikern wichtigklingend für einen raschen Fortschritt verwendet. Daß der Quantensprung
aber auch rückwärts erfolgen kann, will man dabei nicht bedenken oder man weiß das gar nicht. Das paßt nicht in die
Absicht, mit wissenschaftlichem Vokabular anzugeben. Also täuscht man Bildung vor, die man gar nicht hat, vertraut
darauf, daß es auch der Zuhörer nicht weiß, und macht sich mit seinem Vokabular lächerlich.
- Aus der Astronomie:
Über eine Darstellung, einen Vorgang oder einen Prozeß sagt man, er nähme galaktische Dimensionen an. Wörter
wie groß, riesig, mächtig oder gewaltig reichen nicht mehr, es müssen in der Ausdrucksweise aufschneiderisch alle
Maßstäbe gesprengt werden. Die Mehrzahl derer, die sich solcher Ausdrucksweisen bedient, weiß meist nicht annähernd,
was galaktische Dimensionen sind. Man frage doch mal einen Verwender zum Beispiel, was ein Parsec ist oder ein Lichtjahr
oder was man unter einer Galaxie versteht, kaum wird man etwas Brauchbares erfahren.
- Aus der Mathematik:
Man hört, daß eine Entwicklung in Größenordnungen voranschreitet. Aber da entsteht eine Frage: In welchen
Größenordnungen bitte? Das erfährt man nicht. Die Ausdrucksweise entlarvt sich als das sinnentleerte Verwenden
eines Wortes, das mathematische Kenntnisse suggerieren soll, die man nicht hat. Würde man sagen: Die Grundstückspreise
haben sich gegenüber der DDR in der Größenordnung 102 erhöht, so ergäbe das einen Sinn. Sagt man aber:
Die Grunstückspreise haben sich in Größenordnungen erhöht, so hat das überhaupt keine Aussage. Nebenbei: Muß man
so geschwollen reden? Man kann doch einfach sagen, die Preise haben sich verhundertfacht.
- Aus der Statistik:
Typisches Politikerdeutsch ist der Ausdruck "Prozentpunkte". Da heißt es, eine Partei gwänne bei Umfragen 5 Prozentpunkte
hinzu, eine andere habe 4 Prozentpunkte verloren. Was mögen das für Punkte sein? Zur Klarstellung: Lateinisch pro centum,
deutsch je hundert oder von hundert ist ein relatives Anteilmaß, normiert auf gesamt = 100. Irgendwelche fiktiven
Punkte sind dabei nicht im Spiel. Es sind ganz einfach Protenze. Der Begriff Prozentpunkte ist ohne jeden Sinn.
Der Ausdruck, eine Partei gewänne 5 Prozentpunkte, erzeugt die Frage: Was sind das für 5 von 100 Punkten? Was eigentlich
sind denn Parteipunkte? Wer legt sie fest? Was beinhalten sie? - Gar nichts. Es klingt schön hochtrabend, ist aber
tatsächlich nur Unsinn.
2. Sinnvermissende Zuordnung der Adjektive
Adjektive werden sehr oft nicht sinnentsprechend zu Nomen zugeordnet, so daß eine falsche, zum Teil unsinnige
Aussage entsteht.
-
Die billigen oder die teueren Preise. Nicht die Preise sind billig oder teuer, sondern die zu verkaufenden
Waren oder die angebotenen Leistungen, die Preise sind klein, niedrig oder groß, hoch.
-
Die kühlen, kalten oder die warmen, heißen Temperaturen. Nicht die Temperatur ist kühl, kalt oder warm,
heiß, sondern die Luft, das Wasser oder ein anderes Medium, die Temperatur ist klein, tief, niedrig oder hoch.
-
Die schnellen oder die langsamen Bauzeiten. Nicht die Bauzeiten sind schnell oder langsam, sondern
die Bauarbeiten, die Bauabläufe. Die Bauzeiten sind gering, niedrig, klein, kurz oder lang. Es gibt überhaupt keine
schnellen oder langsamen Zeiten.
-
Die größere oder die kleinere Hälfte. Das ist widersinnig. Die Bedeutung des Begriffes Hälfte wird
hierbei unterlaufen.
3. Die unnütze Verwendung von irgend.
Gemeint ist die Verwendung von irgend zu unnötigen Füllzwecken, also nicht zum Beschreiben eines nicht
genau zu benennenden Vorgangs. Sie ist oft undurchsichtig und meist überflüssig.
- Das habe ich irgendwo nicht verstanden. (Nicht im Kopf, sondern woanders? Aber wo?)
- Irgendwie kennt er mich nicht. (Völlig unklar. Kennt er mich nun oder nicht?)
- Das kann man irgendwie nicht erklären. (Nicht oder irgendwie - das ist hier die Frage.)
- Das Neue ist irgendwie besser. (Das geht gar nicht. Entweder es ist besser oder eben nicht.)
- Zwei Parallele schneiden sich irgendwo im Unendlichen. (Also, wo denn nun?)
4. Worte oder Wörter
Häufig wird der Plural Worte für Wörter verwendet. Die beiden Pluralausdrücke bedeuten aber verschiedenes:
- Der Plural Wörter bezeichnet die Elemente eines Satzes. Es sind morphologische Einheiten, syntaktische Elemente.
- Der Plural Worte bezeichnet Aussprüche, Sinnsprüche, Denksprüche, Sentenzen.
Beispiele:
- Die Worte im Duden sind alphabetisch geordnet. (Falsch. Es sind Wörter.)
- Alle diese Worte werden kleingeschrieben. (Falsch. Auch das sind Wörter.)
- Denk an die Worte deines Vaters! (Richtig. Der Vater hat etwas zu bedenken gegeben.)
- Die Worte deiner Aussage gaben mir zu denken. (Richtig.)
- Die Wörter dieser Aussage sind falsch angeordnet. (Richtig.)
5. Diskurspartikel
Diskurspartikel sind unnütze Sprachfüllaute ohne semantische, ohne syntaktische und ohne inhaltliche Bedeutung.
Sie sollten beim Sprechen nach Möglichkeit vermieden werden.
Häufige Diskurspartikel sind:
- Äh, ähm, öhm, eh, ehm, aah.
- Zum Abschluß einer Rede findet man oft, wenn einer nichts mehr zu sagen hat, aber noch reden möchte, ein
bedeutsam klingendes äh, ja.
Ein Sprecher, der überhäuft Diskurspartikel in seine Rede setzt, zeigt, daß er seine Gedanken nicht beisammen hat.
Er malträtiert seine Zuhörer mit undurchdachtem Gerede. Diskurspartikel sind eine Art inhaltliches Stottern. Man kann
nur empfehlen: Vor dem Sprechen Gehirn einschalten. Übertriebene Anhäufungen von Diskurspartikeln findet man
nicht nur - oft sogar weniger - bei bildungsfernen Bevölkerungsschichten. Alle sind davon befallen: Wissenschaftler,
Politiker, Journalisten, Künstler, Moderatoren, Kabarettisten, darunter viele, die eine Hochschule abgeschlossen haben.
Als Ursachen kann man ermitteln, daß, begonnen in unseren Schulen und Lehreinrichtungen, in den meisten Fällen
nicht mehr auf die Sprache geachtet wird. Sprache wird immer weniger als äußerer Ausdruck des Bildungsstandes
angesehen. In Facharbeiten an unseren Schulen wird die Qualität der Sprache nicht mehr bewertet. Eine ordentliche
Sprache hat eine immer geringere Bedeutung für das Ansehen einer Person. Es gibt nur noch ganz wenige Menschen,
die beim Sprechen Sätze formulieren, die man auch aufschreiben könnte. Natürlich passiert es schon mitunter, daß
man im eiligen Redefluß, zum Beispiel bei einer Auseinandersetzung, ein Diskurspartikel einfügt. Das ist unvermeidlich
und wird auch akzeptiert. Lästig ist es aber, wenn ein Sprecher sie in kurzen Sätzen massenhaft verwendet.
Verschiedentlich wird jedoch versucht, einer solchen Sprechweise einen positiven Anstrich zu verleihen, das ständige
"ähm"-Sagen zu rechtfertigen, es salonfähig zu machen. In der freien Enzyklopädie Wikipedia findet man dazu eine
Definition, die völlig neben der Sache, ja, beinahe absurd ist:
"Diskurspartikel oder Diskursmarker sind Wörter", heißt es, "die das Gespräch steuern und keine eigentliche semantische
Bedeutung haben, wie zum Beispiel im Deutschen also oder ähm. Sie haben interaktionsstrategische Funktionen oder
tragen zur Strukturierung von Äußerungen bei."
(http://de.wikipedia.org/wiki/Diskurspartikel).
Ich halte das für völlig leeres, mit vielen Fehlern behaftetes Gerede, das mir eine Kommentierung abverlangt.
- Diskurspartikel sind keine Wörter. Sie sind Lautäußerungen, die nicht zu den Elementen einer
Sprache gezählt werden.
- Diskurspartikel haben nicht nur "keine eigentliche", sondern überhaupt keine semantische Bedeutung.
- Also ist kein Diskurspartikel, sondern ein Wort. Also kann in der Bedeutung von folglich,
mithin, demnach oder ergo (lateinisch) verwendet werden:
- Er hat die Frage nicht beantwortet, also kennt er die Antwort vermutlich nicht.
- Ich denke, also bin ich.
- Unsere Kenntnisse zu diesem Thema sind noch lückenhaft, also müssen wir noch lernen.
- Hier endet der Weg. Man kann also nur in zwei Richtungen weitergehen: nach links oder nach rechts.
- Diskurstpartikel "steuern" das Gespräch überhaupt nicht. Sie hindern den Zuhörer am Erkennen des
Redeinhalts und des Satzbaus und erfordern unnützen, zusätzlichen Aufwand, den Sprecher zu verstehen.
- Diskurspartikel haben keinerlei "interaktionsstrategische" Funktionen. Die erhalten sie auch nicht durch
ungeheuerlich hochgestochene Begrifflichkeiten wie "interaktionsstrategisch". Der Leser vermag kaum abzubilden,
was damit gemeint sein könnte. Diskurspartikel zerstückeln den Redefluß, weil der Sprecher die Gedanken, die er
äußern möchte, noch nicht fertiggefaßt hat und befürchtet, in einer möglichen Redepause unterbrochen zu werden.
- Diskurspartikel tragen in keiner Weise zur "Strukturierung von Äußerungen" bei. Sie sind lästiges Beiwerk
der Rede, das dazu führen kann, daß der Zuhörer sich abwendet. Man erwartet von einem Sprecher, seine Gedanken
so zu formulieren, daß man sie unterbrechungsfrei verstehen kann. Dazu sind Diskurspartikel kontraproduktiv.
Fazit: Die in Wikipedia eingetragene Definition ist völlig falsch, ist undurchdachtes Geschwätz, hat keine wissenschaftliche
Grundlage und senkt bei ihrer Aufnahme in eine Enzyklopädie deren Akzeptanz und Glaubwürdigkeit.
6. Nichtssagende Ausdrücke
Gemeint sind hier Floskeln, die hochtrabend klingen, tatsächlich aber keine Aussage haben, folglich bedenkenlos
weggelassen werden können.
- sag ich mal...
- ich sag mal so...
- sag ich mal eben...
- sozusagen...
- gewissermaßen quasi...
- sukzessive...
- halt...
- und und und... (für und so weiter)
- wenn Sie so wollen...
Es ist auch nicht von der Hand zu weisen, einmal über folgendes nachzudenken. Oft sagt man: "Ich bedanke mich
bei Ihnen." Wie kann man das machen? Sollte man nicht sagen: "Ich danke Ihnen.", um jemandem seinen Dank
auszudrücken? Wie bedankt man sich eigentlich selbst? Und dann noch bei einem anderen? Das ist ein logischer
Purzelbaum. Dann müßte man ja auch sagen dürfen: "Ich begrüße mich bei Ihnen.", statt "Ich grüße Sie.",
um jemandem seinen Gruß zu erweisen. Es wäre dann auch die Aussage als richtig anzusehen "ich entschuldige mich bei
Ihnen." Das geht gar nicht. Niemand kann sich selbst "entschuldigen". Ich kann einen anderen um Entschuldigung bitten,
also ihn bitten, mir meine Schuld abzunehmen.
7. Die Wortanordnung im Satz
- Die Wortstellung in Sätzen mit weil und denn ist nicht gleichgültig.
Wir können es lernen, weil es ist nie zu spät. Der Satz enthält einen grammatischen Fehler. Er muß lauten:
Wir können es lernen, weil es nie zu spät ist. Oder: Wir können es lernen, denn es ist nie zu spät.
Während der Wortstellungsfehler in Sätzen mit weil sehr oft vorkommt, wird er in Sätzen mit denn nicht beobachtet.
Wie kommt das? Dieser Fehler hat seinen Ursprung in fehlerhaften Übersetzungen aus dem Englischen. Dort ist nach
weil (because) die Wortstellung wie im ersten Satz richtig, im Deutschen jedoch nicht.
- Die Wortstellung im Fragesatz.
Sie wollen ein neues Auto? In diesem Satz ist das Fragezeichen falsch. Der Satz ist kein Fragesatz, sondern ein
Aussagesatz. Der Fragesatz muß lauten: Wollen Sie ein neues Auto? Dieser Mißbrauch der Wortstellung wird äußerst
forciert von der Werbung vorangetrieben. Er soll dem Fragesatz in aggressiver Weise eine Bestimmtheit verleihen. Dies
widerspricht aber den grammatischen Regeln des Deutschen. Jedoch wird der Fehler so massiv verwendet, daß viele
Deutsch-Muttersprachler ihn bereits nicht mehr als Fehler empfinden. Dies ist ein beredtes Beispiel für die aktive
Sprachzerstörung durch die Werbung. Ein Werbetexter formulierte das so: "Wir haben nicht die Aufgabe, die Sprache
zu pflegen, sondern ein Produkt zu verkaufen." Hier wird ein Gegensatz konstruiert, der nicht existiert. Man kann
ein Produkt auch in ordentlicher Sprache bewerben.
8. Der Dativ anstelle des Genitivs
Oft gibt es Kasusfehler, zum Beispiel mit der Präposition wegen.
- Wegen seinem Übergewicht hat er Herzbeschwerden (wegen seines Übergewichts).
- Wir sind wegen dem Stau zu spät gekommen (wegen des Staus).
Viele Deutsch-Muttersprachler haben - warum auch immer - eine unbegründete Abneigung gegen die Verwendung
des Genitivs.
- Statt der Name des Vogels sagen sie lieber der Name von dem Vogel.
- Ausdrücke wie Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland statt Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands findet man
in großer Zahl. Besonders schlimm klingt Bern ist die Hauptstadt von der Schweiz.
- Der Motor von dem Auto ist defekt (der Motor des Autos).
- Bastian Sick hat sarkastisch formuliert: "Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod." Ganz sicher spielt hier die Bildung
des Genitivs im Englischen mit of eine Rolle. Die Übersetzung der Präposition of mit von führt
aber im Deutschen zum Dativ und damit zu einer erhöhten Fehlerzahl.
Auch wird häufig die Präposition von verwendet, wo es über heißen muß:
- Wir wissen wenig von diesem Mitarbeiter (über diesen Mitarbeiter).
- Ich werde morgen vom Sport berichten (über den Sport).
- Aber richtig ist: Von diesem Lehrer lernen wir viel. Auch richtig ist über diesen Lehrer lernen wir viel.
Aber das ist eine ganz andere Aussage.
9. Einiges zum Genderdeutsch
Dies ist ein ganz böses Kapitel sprachlicher Verunstaltung. Die vermeintliche Gleichbehandlung von Männern und Frauen
oder die sogenannten "geschlechterneutralen" Formulierungen sind völlig unnütz, niemand braucht sie, und außer
durch Politiker, die sie massiv vorantreiben und sogar "Rechtsvorschriften" dazu initiieren, was immer das sein mag,
werden sie von den deutschsprechenden Völkern im wesentlichen ignoriert. Das ist sicher der gesündeste Part in diesem
Prozeß. Frauen mit Bildung und Intelligenz begrüßen das Genderdeutsch auch nicht. Auch die orthographischen Auswüchse
wie Schrägstrich-innen oder ein großes I inmitten eines Wortes (Mitarbeiter/innen, MitarbeiterInnen) werden
in den deutschsprechenden Völkern mehrheitlich abgelehnt.
Hier einige Tendenzen und Beispiele, die den ganzen Unsinn zeigen.
- Die in allen Lebensbereichen erhobene Forderung nach ständiger Doppelnennung der Geschlechter gilt merkwürdigerweise
nicht ohne Einschränkung. Zum Beispiel wird
- Täterinnen und Täter,
- Verbrecherinnen und Verbrecher,
- Diebinnen und Diebe oder auch
- Betrügerinnen und Betrüger
nicht gefordert. Warum eigentlich nicht? In allen anderen Fällen wird ja die sogenannte "Gleichbehandlung" von
Männern und Frauen kategorisch verlangt. Möglicherweise soll mit dem Fehlen weiblicher Benennungen weibliche
Kriminalität geleugnet werden. Das widerspricht aber den Tatsachen der gegenwärtigen Entwicklung.
Der wahre Grund ist jedoch woanders zu finden. Das Genderdeutsch wurde forciert inszeniert, als sich die Frauen
im Jahre 1918 in Deutschland endlich das Wahlrecht erkämpft hatten. In dieser Errungenschaft haben Politiker das
große Potential erkannt, welches die Frauen als Wähler darstellen, und so begann man, um diese Wählerstimmen
zu buhlen, mit allen Mitteln, auch mit sprachlichen. Dafür sind natürlich Negativbegriffe wie oben ungeeignet. Der
Prozeß verlief im Einklang mit militanten Feministen (das sind Männer und Frauen! Man muß das heute schon explizit
sagen), die mit großer Intensität begannen, glaubhaft machen zu wollen, das grammatische Genus eines Begriffes
sei mit dem biologischen Geschlecht des Begriffsträgers gleichzusetzen und folglich seien mit dem maskulinen
grammatischen Genus Frauen aus der Nennung ausgeschlossen. Die Sprachwissenschaft versucht geradezu mit
Engelzungen, diesen Irrtum aufzuklären. Bedauerlicherweise sind aber Politiker und Feministen stärker und setzen
mit grobem Machtgehabe ihre beschränkten Sprachkenntnisse durch.
- Die Begriffskombination Mitglieder und Mitgliederinnen, die ich in einer Gewerkschaftszeitung aufgefunden
habe, ist vermutlich von einem Politiker: Weiblich um jeden Preis, auch wenn es grammatisch völlig unmöglich ist. Es ist
zwar falsch, aber es klingt gut, und das ist wichtiger.
- Brautpaar. Warum eigentlich nicht Braut/Bräutigampaar? Eine Braut allein ist schließlich noch kein Paar.
Der Begriff Brautpaar ist ja nun doch sehr weiblich besetzt, so daß kaum die Gefahr der Realisierung meiner
Idee besteht, Männer kommen seltener auf solche ulkigen Vorschläge.
- Der Mensch - grammatisch maskulin, eine feminine Form gibt es nicht. Nach dem irrigen Sprachverständnis
derer, die das grammatische Genus und das biologische Geschlecht immer noch als dasselbe ansehen, so daß also
grammatisch maskulin biologisch männlich bedeute, können demnach nur Männer Menschen sein, weil Frauen, wie
jeder weiß, nicht männlich sind.
- Die Persönlichkeit - grammatisch feminin, eine maskuline Form existiert nicht. Nach der politisch suggerierten
Sprachfehlleistung, grammatisch feminin sei biologisch weiblich, könnten deshalb nur Frauen Persönlichkeiten sein,
denn Männer sind nicht weiblich.
- Der Junge ist grammatisch maskulin. Heißt das, daß er männlich ist? Wie sollen wir dann das Mädchen
verstehen? Es ist nicht feminin, es ist ein Neutrum. Also, nicht weiblich? Wie nun? Hier muß man tatsächlich das
biologische Geschlecht betrachten: Ehe der Junge ein Mann wird, vergehen 16 bis 18 Jahre, und dann ist er kein
Junge mehr. Der Junge ist also nicht männlich, sondern grammatisch maskulin. Bei dem Mädchen dauert es auch
etwa so lange, ehe es eine Frau wird. Aber das Mädchen ist ja ohnehin nicht weiblich, pardon, nicht feminin.
- Ich will einmal als Beispiel mit dem Genderdeutsch ein Problem der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
behandeln. Ich treffe die Feststellung Angela Merkel ist der achte Bundeskanzler der Bundesrepublik. Sofort
werde ich attackiert: Angela Merkel sei nicht Bundeskanzler, sondern Bundeskanzlerin. Ich korrigiere
also: Angela Merkel ist die achte Bundeskanzlerin der Bundesrepublik. Nun aber ist die Aussage falsch, denn
die anderen waren alle sieben Männer. Um die Aussage richtigzustellen, korrigiere ich wieder: Angela Merkel ist die
erste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik. Das ist zwar richtig, aber darum ging es gar nicht. Die Aussage, die
ich vornehmen will, kann man mit dem Genderdeutsch gar nicht mehr ausdrücken, ohne auf die orthographischen
Mißgestaltungen mit dem Schrägstrich oder großem I zurückzugreifen.
- All diese Wirrnisse entstehen nur durch das Genderdeutsch. Es taugt zu nichts, außer zu großem Unsinn. Hier aber
hätte es wirklich Sinn, sich einmal am Englischen zu orientieren. Dort gibt es solche Probleme nicht, obwohl es auch
im Englischen feminine Formen gibt. Zum Beispiel authoress - die Autorin. Aber sie werden nicht verwendet.
Die englischsprechenden Völker wollen sie nicht haben.
- Dieses ganze Prozedere führt dann zu abartigen Auswüchsen, wie einerseits zu den absurden Darstellungen im
Entwurf einer Verordnung über das Fleischhygienerecht aus der Feder Herrn lic. iur. Urs-Peter Müllers vom Bundesamt
für Veterinärwesen der Schweiz oder andererseits zu der völlig konfusen Formulierung in einer Dissertation, beides
gefunden durch den Schweizer Sprachwissenschaftler Dr. Arthur Brühlmeier, nachlesbar unter
http://www.unipohl.de/Appell.htm,
dort Abschnitt 2., Staatsfeminismus.
- Welch unglaubliche Blüten der militante Feminismus in Verbindung mit politischem Machtgetöse in seiner Endphase
austreiben kann, erfährt man an der Universität Leipzig, an der - angeregt durch die Rektorin Professor Doktor Beate
Schücking - grammatisch maskuline Benennungen per Senatsbeschluß abgeschafft werden sollen und den abstrusen
Benennungen wie zum Beispiel Herr Professorin, Herr Doktorin oder Herr Dozentin zu weichen haben. Andere Universitäten
sollen folgen. Ausführlicher beleuchtet habe ich dies unter
http://www.unipohl.de/Femininmaenner.htm.
10. Partizipien im Genderdeutsch
Partizipien werden vermehrt anstelle der Nomen als sogenannte "geschlechterneutrale" Ausdrücke verwendet, weil mit
der Zeit auch den härtesten Genderdeutsch-Vertretern die permanenten Doppelnennungen als unangenehm und lästig
auffallen. So heißt es nun fortan:
- Studierende statt Studenten,
- Radfahrende statt Radfahrer,
- zu Fuß Gehende statt Fußgänger,
- Verkehrsteilnehmende statt Verkehrteilnehmer,
- Reitende statt Reiter,
- Lernende statt Schüler,
- Lehrende oder Unterrichtende statt Lehrer usw. usf.
Abgesehen von den stilistischen Verfehlungen ist nun aber mit dieser Ausdrucksweise das Problem nicht behoben.
Zum Beispiel ist Studierende keineswegs "geschlechterneutral", wie man darzustellen versucht, denn es gibt
nun die Studierende und der Studierende, nur sieht man es nicht gleich wegen der Kongruenz der
Formen. Also schon an dieser Stelle ist das ganze ein Flop. Aber mit dieser Redeunsitte entsteht ein anderes, weit
schlimmeres Dilemma: Der Bedeutungsunterschied zwischen Nomen und Partizipien wird durch den Dauergebrauch
dieses falschen Deutschs verwischt. Ein Beispiel. Ich habe die Straßenverkehrsordnung in der Fassung vom 1. April 2013
nach der Einführung der sogenannten "geschlechterneutralen" Formulierungen aufs genaueste studiert. Das Ergebnis
kann man hier einsehen: http://www.unipohl.de/StVO.htm.
Mit der Ausführung dieses Studiums und der anzufertigenden Analyse bin ich also ein Studierender der StVO. Bin ich
nun auch ein Student der StVO? Wer noch nicht gänzlich dieser Sprachentstellung verfallen ist, wird die Frage sicher
verneinen. Ein Student (Mann oder Frau!) ist eine an einer Lehreinrichtung eingeschriebene Person, mit dem Ziel,
ein Studium zu absolvieren und die erworbene Qualifikation durch bestandene Prüfungen und Examen nachzuweisen.
Ein Studierender ist also etwas völlig anderes. So sieht man denn, daß mit solchen Sprachdoktrinen lediglich
eines erreicht wird: Es wird in der deutschen Sprache großer Schaden angerichtet.
11. Der untergehende Konjunktiv
Es gibt in der deutschen Rede Aussagen, die ohne den Konjunktiv nicht auskommen, ja, das Fehlen des Konjunktivs
ist an bestimmten Stellen ein grammatischer Fehler.
- Ein Rundfunkmoderator sagte am Ende einer Sendung: "Wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder dabei sind."
Das ist falsch. In diesem Satz muß ein Konjunktiv stehen. Der Indikativ ist hier ein grammatischer Fehler. Ist ja sogar
sachlich falsch, denn der Moderator kann ja gar nicht wissen, ob der Hörer morgen wieder dabei ist. Deshalb muß
es zwingend heißen: Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder dabei wären, oder wir freuten
uns, wären Sie morgen wieder dabei.
- Er sagte, er ist nicht dazu bereit. Das ist auch falsch. Es ist eine indirekte Rede. Hier muß der Konjunktiv I stehen:
Er sagte, er sei dazu nicht bereit.
- Der Konjunktiv verarmt in der Gegenwartssprache durch einseitige Bildung mit würde und wäre, die Verbformen
des Konjunktivs werden kaum noch verwendet:
- Wir würden ihm helfen, würde er uns darum bitten.
Die Form wir hülfen ihm, bäte er uns darum, wird von vielen, insbesondere jungen Menschen altmodisch genannt
und größtenteils nicht mehr verwendet. Viele kennen diese Formen gar nicht mehr, die heutige Generation der Deutschlehrer
unterrichtet sie nicht mehr. Das ist sehr schade, denn die deutsche Sprache ist sehr reich an Verbformen des Konjunktivs:
- Träfen wir uns, so sähen wir uns.
- Gestern meinten wir noch, sie käme.
- Sprächen wir uns aus, klärten wir vieles einfacher.
- Nähme ich die Medizin, fühlte ich mich besser.
- Hielte ich immer Wort, glaubte man mir stets.
- Wir bewegten uns gefahrloser im Internet, berücksichtigten wir stets, daß sich höhere Sicherheit durch gezügelte
Neugier erreichen läßt.
12. Sprachscherze werden ernst genommen
Es gibt eine Reihe Sprachscherze, die in humoristischen oder satirischen Texten durchaus verwendet werden können
und dürfen. Wenn sie aber als ernst genommene Formulierungen in die deutsche Sprache einzugehen drohen, darf
man schon ein kritisches Wort finden. Gemeint sind Begrifflichkeiten wie
- in keinster Weise,
- noch und nöcher,
- nichts desto weniger trotz,
- unkaputtbar
und einige andere. Sie verletzen zwar die deutsche Grammatik, haben aber humoristischen Wert, mit dem man die
Aufmerksamkeit für bestimmte Aussagen mit Heiterkeit verstärken kann, wohl wissend, daß man solche Formulierungen
nicht überall verwenden darf.
In die Reihe dieser Scherzausdrücke gehört auch frau als Pendant zum unbestimmten Fürwort (Indefinitpronomen)
man, das heute von einigen Feministen schon als "normal" empfunden wird und einen Platz in der Grammatik beanspruchen
möchte, weil man im Indefinitpronomen man etwas Männliches zu erkennen glaubt. Nun liegt ja die Zeit, in der man
dies möglicherweise noch annehmen mußte, etliche hundert Jahre zurück. Der Versuch, diese Ansicht nun in die heutige
Zeit zu verlegen und man als männlich wiederzubeleben, zeugt schon von gar arg fossilen Denkmustern. Amüsant ist
dabei aber, daß die Verfechter solch altertümlicher Denkansätze genau diejenigen sind, welche die Bewahrer vernunftgetragener
Traditionen der deutschen Sprache die ewig Gestrigen nennen. Diesen geistigen Kopfstand muß man erst einmal
zuwegebringen.
Man könnte hier durchaus auch das immer häufigere Sinn machen einordnen. Stets und ständig macht etwas
Sinn. Man kann aber Sinn eben nicht machen. Etwas kann Sinn haben oder es kann sinnvoll sein. Und
wieder sehen wir, daß viele mit dem Englischen nicht klarkommen. Dort heißt es make sense. Das ist richtig. Nur
eben die wortgetreue Übersetzung ist falsch.
13. "Neue" Schreibweisen
Man liest mitunter in einigen Texten "neue" Schreibweisen deutscher Ausdrücke, bei denen die Erklärungen der
Rechtschreibreformer zur Getrennt- und Zusammenschreibung in unserer Sprache in gedankenlosem Gehorsam allzu
übereifrig gehandhabt werden. Zitat aus den Vorbemerkungen im Regelwerk der Rechtschreibreform zum Abschnitt
Getrennt- und Zusammenschreibung: "(2) Bei der Regelung der Getrennt- und Zusammenschreibung wird davon
ausgegangen, dass die getrennte Schreibung der Wörter der Normalfall und daher allein die Zusammenschreibung
regelungsbedürftig ist." Es ist sehr leicht zu erkennen, daß dies völlig daneben ist. Getrennt- und zusammengeschriebene
Begriffe haben meist verschiedene Bedeutung und sind beide erforderlich. Eine Regelung auf die angegebene Weise
ist schon deshalb völlig unbrauchbar. Das bekannteste Beispiel ist der allein stehende Baum (in seiner Nähe
stehen keine anderen Bäume) und die alleinstehende Frau (eine Frau, die keinen Partner hat). Mit dieser
obigen Festlegung haben die Reformer mit großer Wucht in die Fäkalien gegriffen. So liest man denn auch oft
- üblicher Weise,
- folgender Maßen,
- sonder Bar,
- manch Mal,
- vor erst,
- unter dessen,
- vorder gründig,
sogar
- wind Stille,
- elektro Technik,
- Kapillar Technologie,
- Obst Torte, Sahne Torte, Erdbeer Torte und
- Fahrzeug Schein
habe ich schon gefunden. Alle diese Schreibweisen sind orthographische "Miss Leistungen". "Konsequenter Weise"
müßten wir dann auch schreiben: hoch Schule, Straßen Bahn, Leder Schuhe, Tisch Decke, Haus Meister, auf wieder
Sehen, Auto Reifen usw. usf. Die Lesbarkeit solcher Stilblüten ist sehr erschwert, und eine Satzanalyse zur Bestimmung
der enthaltenen Satzglieder ist gar nicht mehr möglich.
14. Begriffe und Beschreibungen
Begriffe im Deutschen haben einen allgemeinverständlichen Inhalt und in der Regel keine beschreibende Funktion.
Es sind Vokabeln, bei deren Hören oder Lesen alle Mitglieder der Sprachgemeinschaft und auch Menschen, die Deutsch
als Fremdsprache erlernt haben - heißt, alle Deutschkundigen - etwa das gleiche assoziieren. Besondere Beschreibungen
der deutschsprachigen Begriffe sind also völlig unnütz. Jeder Deutschsprechende weiß zum Beispiel, was unter dem
Begriff der Tisch zu verstehen ist. Eine beschreibende Eigenschaft hat aber weder das Wort noch der Begriff.
Wäre dies notwendig, müßten wir bebeinte Horizontalplatte oder ähnliches sagen. Auch die Tür ist ein
Begriff, keine Beschreibung. Jeder weiß, was eine Tür ist, einer Beschreibung oder Erklärung, wie etwa
Mauerdurchbruchsverschließbrett bedarf es nicht. Es entstünden damit auch neue Probleme, denn der enthaltene
Begriff Brett müßte wiederum definiert werden, weil er nichts beschreibt, sondern ein Begriff ist, und so setzte
sich das fort. Daß ein Begriff keine Beschreibung ist und auch keine braucht, ist eine grundsätzliche Eigenschaft der
Begriffe in einer Spache. Nun gibt es in dem Bestreben einzelner Personen oder Gruppen, die Sprache "verbessern"
zu wollen, die Tendenz, dies nicht zu akzeptieren. Nicht erst in neuerer Zeit, sondern auch schon früher.
So hat zum Beispiel in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein findiger Technologe festgestellt, daß mit
einem Schraubenzieher ja an einer Schraube gar nicht gezogen, sondern gedreht wird. So schuf er das Wort
der Schraubendreher, und viele schlossen sich diesem Irrtum einer Notwendigkeit des Beschreibens an, glaubten,
das neue Wort benenne das Werkzeug besser. Aber Schraubenzieher ist nach meinem Empfinden ganz treffend,
zieht man doch damit eine Schraube fest. Schraubendreher sagt gar nichts. Viel eher müßte man dann besser den
Schraubenzieher vom Schraubenlöser unterscheiden. Nicht nötig, denn es ist dasselbe Werkzeug. Wie
auch immer. So fand das wesentlich unglücklicher gewählte Wort Eingang in technologische Texte, in technische
Beschreibungen, sogar in Normtexte der Werkzeugbranche. Es sind jedoch stets kleine Gruppen, die sich mit solchen
Neuschöpfungen von der Sprachgemeinschaft absondern. Im allgemeinen Sprachgebrauch konnte der Schraubenzieher
nicht verdrängt werden. Genauso, wie der Haareschneider den Friseur nicht ablöste. Ähnlich verhält es
sich mit der Glühbirne, die heute Leuchtmittel heißen soll, oder dem Zollstock, den verschiedene
Sprachverschlimmbesserer Gliedermeßstab nennen.
Solche Bestrebungen führen dazu, daß die Sprache in regionale oder sachbezogene Gruppen zerstückelt und so die
Einheitlichkeit der Sprache untergraben wird. Besonders ausgeprägt sind diese Tendenzen in Behörden, Amtern und
anderen gesellschaftlichen Einrichtungen, insbesondere in der Justiz. So kommt es dazu, daß große Teile der Sprachgemeinschaft
die sogenannte Amtssprache Deutsch schwer oder nicht mehr verstehen. Schaut man zum Beispiel einmal in eine deutsche
Geburtsurkunde, so findet man nicht vor, daß ein Knabe oder ein Junge oder ein Mädchen geboren
wurde, nein, es steht dort ein Kind männlichen oder weiblichen Geschlechts. Den normalen Deutschkundigen
befällt beim Anblick solcher Benennungen meist ein Grinsen und ihm fällt auf, daß beides falsch ist: Bis ein Neugeborenes
ein Mann oder eine Frau wird, vergehen 16 bis 18 Jahre. Frauen und Männer werden nicht geboren, immer
nur kleine Kinder. Den Beamten aber erscheinen die üblichen deutschen Begriffe und Bezeichnungen offenbar zu trivial,
man will sich "gehobener" ausdrücken, oder es ist die erklärte Absicht, so zu sprechen, damit die Allgemeinheit es
nicht mehr versteht und in Ehrfurcht vor der hochtrabenden Juristensprache erstarrt. Wie sonst könnte man die
nachfolgend aufgezählten "Begriffe" einordnen, die - ich muß das anmerken - nicht ich erfunden habe, sondern die
offizielle Benennungen im sogenannten Amtsdeutsch sind. Man nimmt solche Ausdrucksweisen, bei denen man ohne
eine Erklärung kaum erkennen kann, worum es sich handelt, mit Kopfschütteln zur Kenntnis und weiß dabei, daß solche
Sprachexzesse nur einer begrenzten Anzahl Personen vorbehalten sind.
|
Amtsdeutsch |
Deutsch |
|
Personenvereinzelungsanlage |
Drehtür |
|
Lebensberechtigungsbescheinigung |
Familienstammbuch |
|
Betriebsmittelaufnahme |
Betankung |
|
Raumübergreifendes Großgrün |
Baum |
|
Rauhfutterverzehrende Großvieheinheit |
Rind |
|
Spontanvegetation |
Unkraut |
|
Straßenbegleitgrün |
Grünstreifen |
|
Lichtzeichenleitanlage |
Verkehrsampel |
|
Dreiseitenkipper |
Schubkarre |
|
Mehrstück |
Kopie |
|
Mobile ethnische Minderheiten |
Sinti und Roma |
|
zu verunmöglichen |
unmöglich zu machen |
|
Xenologismus |
Fremdwort |
Das sind nur Beispiele. Forscht man weiter, wird die Liste ganz erheblich länger und man könnte noch mehr darüber
lachen, wäre es nicht so ernst. Natürlich erfüllen alle diese "Begriffe", wie man sieht, die Forderung einer beschreibenden
Funktion, auf die aber der Deutschkundige auch gelassen verzichten kann. Eine Ausnahme ist der letzte Begriff, mit
dem das Fremdwort endlich selbst zum Fremdwort gemacht wird.
Resümee:
Wäre ich Inhaber eines gehobenen Amtes im Weinvertrieb, würde ich zum Beispiel den Satz Der Küfer hat den Spunt
gezogen und das Faß auslaufen lassen so umformulieren: So hat doch der Küfer vermittels Herausziehung des
Einfüllöffnungsverschlußholzes das diesbezügliche Flüssigkeitsrollbehältnis zu Auslaufung gebracht. Besser? Man
muß nun nur noch den Küfer beschreibend umbenennen, ich wollte aber an dieser Stelle eventuelle Beleidigungen
eines Berufsstandes vermeiden. Wenn wir am Ende alle so sprächen, hätten wir unsere Sprachprobleme gelöst, dann
wären wir sprachlich alle auf dem Stand eines deutschen Beamten. Tandaradei!
15. Einige Feinheiten der Interpunktion
Worum geht es? Einleitend ist zu sagen, worum es nicht geht. Es geht nicht um die von der Rechtschreibreform verordneten
sogenannten "neuen" Kommaregeln, denn sie passen nicht zum Thema Feinheiten, sie sind grobschlächtig, sie sind
der größte Unfug, der je in der deutschen Sprache fabriziert worden ist. Deshalb finden sie ja auch in der Praxis so gut
wie keine Verwendung. Nach Aussagen der Rechtschreibreformer wurde die Anzahl der Kommaregeln von 52 auf 9
reduziert, wodurch die Kommasetzung nun beliebig statt geregelt ist: Es gibt nun Hunderte Kommaprobleme, die
nicht mehr festgelegt sind. Genauer habe ich mich mit diesen Kommaregeln in den Beiträgen
http://www.unipohl.de/Neudeutsch.htm und
http://www.unipohl.de/Resuemee.htm befaßt.
Lassen wir also die Kommaregeln besser, wie sie früher waren und klären einige Einzelheiten der Interpunktion, die
sehr vielen Schreibern oft Probleme bereiten.
- Satzzeichen und wörtliche Rede
Er sagte: "Ich komme dich besuchen." Klar ist, daß die wörtliche Rede in Anführungszeichen steht und nach
einem Doppelpunkt folgt. Wo aber steht der Punkt hinter besuchen? Außerhalb oder innerhalb der Ausführungszeichen?
Er steht innerhalb. Der Punkt ist der Abschluß des Aussagesatzes und gehört also zur wörtlichen Rede. Wie aber,
wenn der Satz lautet "Ich komme dich besuchen", sagte er. Der Punkt, der am Ende der Aussage hinter besuchen
stehen müßte, kann entfallen, er wird durch den Punkt am Ende des gesamten Satzes "vertreten". Außerhalb der
wörtlichen Rede folgt ein Komma, das die nachgesetzte Ankündigung von der wörtlichen Rede trennt. Da sie nachgesetzt
ist, steht kein Doppelpunkt. Noch eine andere Satzgestaltung. "Ich komme dich besuchen", sagte er, "vielleicht
heute abend." Das Komma zwischen Haupt- und Nebensatz der wörtlichen Rede, das hinter besuchen stehen
müßte, darf hier entfallen. Es wird vom Komma vor der Ankündigung "vertreten". Es muß aber hinter den Ausführungszeichen
stehen.
- Der Umgang mit dem Apostrophen
Der Apostroph, auch Auslassungszeichen oder Ellipsenzeichen genannt, kann als Darstellung für ein fehlendes - ein
flüchtiges - s oder für ein nicht darstellbares Genitiv-s stehen, in bestimmten Fällen auch für ein fehlendes
e. Sonst aber nicht. Falsche Apostrophsetzung findet man im Deutschen überaus häufig. Deshalb hier auch
eine größere Zahl Beispiele:
- Meyers Neues Lexikon. Kein Apostroph vor dem s im Namen Meyer, er ist der Genitiv des
Namens Meyer, er endet auf s. Zu schreiben Meyer's neues Lexikon ist falsch.
- Hans' letzter Brief ist gestern gekommen. Das Genitiv-s des Namens Hans wird durch einen
Apostroph dargestellt, weil sonst Hanss mit zwei s geschrieben werden müßte. Das vermeidet
man im Interesse der Lesbarkeit.
- Bei Auslassung eines das wird kein Aposthroph gesetzt. Man schreibt ans, ins, aufs, übers,
nicht an's, in's, auf's, über's. Sonst müßte man konsequenterweise wegen des ausgelassenen dem
auch vo'm, zu'm, a'm usw. schreiben.
- Fugen-s bei Komposita werden nicht mit Apostroph abgetrennt. Man schreibt Eigentumserwerb,
Vorstandssitzung, Bahnhofsrestaurant, nicht Eigentum's-Erwerb, Vorstand's-Sitzung, Bahnhof's-Restaurant.
- Die Pluralbildung von Lehnwörtern und bestimmten Abkürzungen erfolgt ohne Apostroph. Man schreibt
Kameras, Autos, Videos, Snacks, CDs, nicht Kamera's, Auto's, Video's, Snack's, CD's.
- Für den Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg gibt es die Dialektkurzform Prenzlberg. Zulässig ist hier
Prenzl'berg, aber nicht Prenz'lberg.
- Der Imperativ geh mit mir wird nicht mehr geh' mit mir geschrieben. Es fehlt kein e, die
Imperativform gehe mit mir gilt als veraltet, sie wird nicht mehr verwendet.
- Nicht ganz eindeutig ist die Apostrophsetzung bei Formulierungen wie ich denk an dich oder ich
sag dir etwas. Hier fehlt das e aus den konjugierten Verbformen von denken und sagen.
In solchen Fällen dürfte man es dem Schreiber überlassen, ob er den Apostroph setzt oder wegläßt. Anders aber
bei ich sag's dir jetzt. Hier muß der Apostroph stehen.
- Falsch ist ebenso die in Einzelfällen vorkommende Abtrennung des s bei Wörtern wie nichts, montags,
rechts, links, mittags und anderen. Also nicht nicht's, montag's, recht's, link's, mittag's.
- Es heißt auch nicht Nudel'n, sondern Nudeln, nicht Kugel'n, sondern Kugeln
und nicht Schmid'chen Schleicher, sondern Schmidchen Schleicher.
- Der Doppelpunkt
Der Doppelpunkt (Kolon) wird nach Einleitung vor einem Zitat oder einer wörtlichen Rede gesetzt. Auf den Doppelpunkt
können auch Erklärungen oder Erweiterungen des vorher Gesagten folgen. Nach dem Doppelpunkt wird großgeschrieben,
wenn ein vollständiger Satz folgt. Es kann klein geschrieben werden, wenn Aufzählungen folgen, die nicht mit einem
Substantiv beginnen. Der Doppelpunkt kann nicht am Ende eines Absatzes stehen.
- Kabarettisten haben besondere Rechte: Sie dürfen auch beleidigend werden, ohne eine Anzeige zu riskieren.
- Er nannte sie alle beim Namen: seine Eltern, seine Geschwister und die anderen Verwandten.
- Die Zeitung schrieb: Der Unfallverursacher sei geflüchtet. (keine wörtliche Rede). Statt des Doppelpunktes
kann auch ein Komma gesetzt werden.
- Die Zeitung schrieb: "Der Unfallverursacher ist geflüchtet." (wörtliche Rede). Hier ist der Doppelpunkt
zwingend.
Der Doppelpunkt wird nicht gesetzt, wenn für das Nachfolgende bereits eine andere Ankündigung steht, wie zum
Beispiel also, unter anderem, nämlich, und zwar.
- Wir können mehrere Sorten Zucker unterscheiden, unter anderem Kandiszucker, Würfelzucker und Puderzucker.
- Man sagt, er sei der Beste seiner Klasse, und zwar in Mathematik und in Physik.
- Der Lehrer unterrichtet außer Mathematik noch weitere Fächer, nämlich Physik, Astronomie und technische Mechanik.
- Bindestrich und Gedankenstrich
Der Bindestrich und der Gedankenstrich sind zwei unterschiedliche Zeichen.
Der Bindestrich ist der kurze Strich (–), der mit der Minustaste der Tastatur gesetzt wird. Er wird als Trennstrich oder
als Auslassungsstrich verwendet. Vor und nach dem Trennstrich stehen keine Leerzeichen. Vor dem Auslassungsstrich
steht kein Leerzeichen, nach dem Auslassungsstrich steht ein Leerzeichen oder ein Komma. Im html-Text kann der Code
&ndash ; verwendet werden. Der ASCII-Code des kurzen Striches (Minuszeichen) ist 45 (hex 2D).
Der Gedankenstrich ist der lange Strich (—). Vor und nach dem Gedankenstrich stehen Leerzeichen. In Textverarbeitungssystemen
wird er automatisch gesetzt, wenn vor und nach einem gesetzten Minuszeichen je ein Leerzeichen steht. Mit der Tastatur
ist er nicht erreichbar. Im html-Text kann der Code &mdash ; verwendet werden. Der ASCII-Code des langen Striches (auch Halbgeviertstrich)
ist 196 (hex C4).
Erweiterte ASCII-Codes können durch Eingabe der Codezahl mit der Zifferntastatur bei gehaltener Alt-Taste erreicht
werden.
Beispiele:
Der Trennstrich. Er trennt Wörter eines Begriffes aus Übersichtsgründen (wenn zum Beispiel vier oder mehr Grundwörter
einen Begriff bilden):
- die Hausordnungs-Zusatzbestimmungen,
- die Schwimmeister-Erweiterungskurs-Teilnahmebescheinigung,
oder wenn die Sachlage dies erfordert:
- der Benzinkanister-Verschluß (nicht der Benzin-Kanisterverschluß),
- das Abitur-Abschußzeugnis (nicht das Abiturabschluß-Zeugnis),
oder bei besonderen Hervorhebungen:
- die Ich-Sucht (für Ichsucht),
- die Hoch-Zeit der Inkakultur, um von der Hochzeit (Eheschließung) zu unterscheiden.
Der Auslassungsstrich. Er ersetzt den namensgleichen Teil einer Mehrfachaufzählung, der nur einmal am Ende genannt wird:
- Standard- und Spezialwerkzeuge (Auslassungsstrich für Werkzeuge),
- Haupt- und Nebensaison (Auslassungsstrich für Saison),
- Dampf-, Diesel- oder Elektrolokomotiven (Auslassungsstrich für Lokomotiven).
Der Gedankenstrich. Er trennt zwei aufeinanderfolgende Gedanken oder Aussagen, zwischen denen man auch Komma, Doppelpunkt oder Semikolon setzen könnte:
- Peter ist der Beste — alle wissen das.
- Du kannst das Buch haben — sogar als Geschenk.
Besonders hervorzuhebende Einfügungen in einen Satz können mit zwei Gedankenstrichen abgegrenzt werden:
- Der Begriff die Studenten beinhaltet — das muß man besonders hervorheben — Männer und Frauen.
- Sein mündlicher Ausdruck enthält — meist erkennt er dies jedoch nicht — zahlreiche Ausdrucks- oder Stilformen,
die Mängel in den Grammatikkenntnissen zeigen.
Schlußbemerkungen
Eine Sprache ist ein kompliziert aufgebautes, mit vielen historisch entstandenen und gewachsenen Regeln ausgestattetes
Kulturgut eines Volkes oder mehrerer Völker. Sie entwickelt und verändert sich durch den tagtäglichen schöpferischen
Gebrauch aller Mitglieder der Sprachgemeinschaft. Sie ist ein volksübergreifendes einheitliches Instrument der Verständigung,
des Ausdrucks von Emotionen und des Bewahrens und Erhaltens allgemeingesellschaftlicher Errungenschaften, Erkenntnisse,
Traditionen, Kulturgüter und Organisationsregeln der Völker. Versuchen in einer Sprachgemeinschaft Einzelne oder kleinere
Gruppen, die Sprache nach ihren persönlichen oder privaten Vorstellungen zu verändern und diese Abänderungen den Völkern
aufzuzwingen, so ist das eine vollentwickelte Arroganz. Die Sprache lebt in den Völkern und durch die Völker. Einzelaktionismus
ist nicht gefragt und kann nicht akzeptiert werden. In der Regel wird er von den Völkern nicht geduldet. Sprache unterliegt
nicht der Regulierung durch staatliche Einrichtungen und nicht der Veränderung durch Kommissionen, die sich anmaßen,
einem oder mehreren Völkern die Verwendung ihrer Sprache durch Vorschriften, Gesetze, Erlasse und anderer Verfügungen
vorschreiben zu wollen. Wie sich eine Sprache entwickelt und verändert, bestreiten die Völker, die sie sprechen und schreiben.
Schriftlich festgehaltene Regeln können nur im Konsens mit der gesamten Sprachgemeinschaft als verbindlich gelten. Dies ist
ein langsamer, über Jahrzehnte und Jahrhunderte ablaufender Prozeß, der nicht mit Willkür beeinflußbar ist. Zur Erinnerung:
Die sogenannte Rechtschreibreform wurde in Geheimsitzungen der Reformkommission, später des Rates für deutsche
Rechschreibung, ausgearbeitet und danach als angeblich verbindlich für die Sprachgemeinschaft bekanntgegeben.
Widerspruch wurde nicht geduldet. Ein solches Vorgehen kann nicht anerkannt werden. Sprache ist nicht administrierbar.
Leider spielt sich in Deutschland der Staat als Eigentümer der Sprache auf und versucht, dem deutschen Volk andere
als die historisch entstandenen Sprachregeln zu diktieren. Zur Erinnerung: Das Regelwerk der deutschen Rechtschreibung
wurde als ganzes abgeschafft und durch ein anderes, zum großen Teil unbrauchbares, ersetzt. Dies trägt nicht zur Entwicklung
der deutschen Sprache bei, sondern führt auf Dauer zur ihrer Zerstörung. Das politisch inszenierte Genderdeutsch hat bereits
großen Schaden an der deutschen Sprache verursacht. Dies wird jedoch von den dafür verantwortlichen Politikern wegen ihrer
stark eingeschränkten Deutschkenntnisse gegen alle Bestrebungen der sprachwissenschaftlichen Aufklärung bestritten
und wider besseres Wissen mit Selbstherrlichkeit durchgesetzt. Jeder verantwortungsbewußte Deutsche hat das Recht,
sich auf den Artikel 20, Absatz (4), des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland zu berufen und sich diesen
demokratie- und rechtswidrigen Vorgehensweisen zu verweigern. Die Sprache gehört dem Volk.